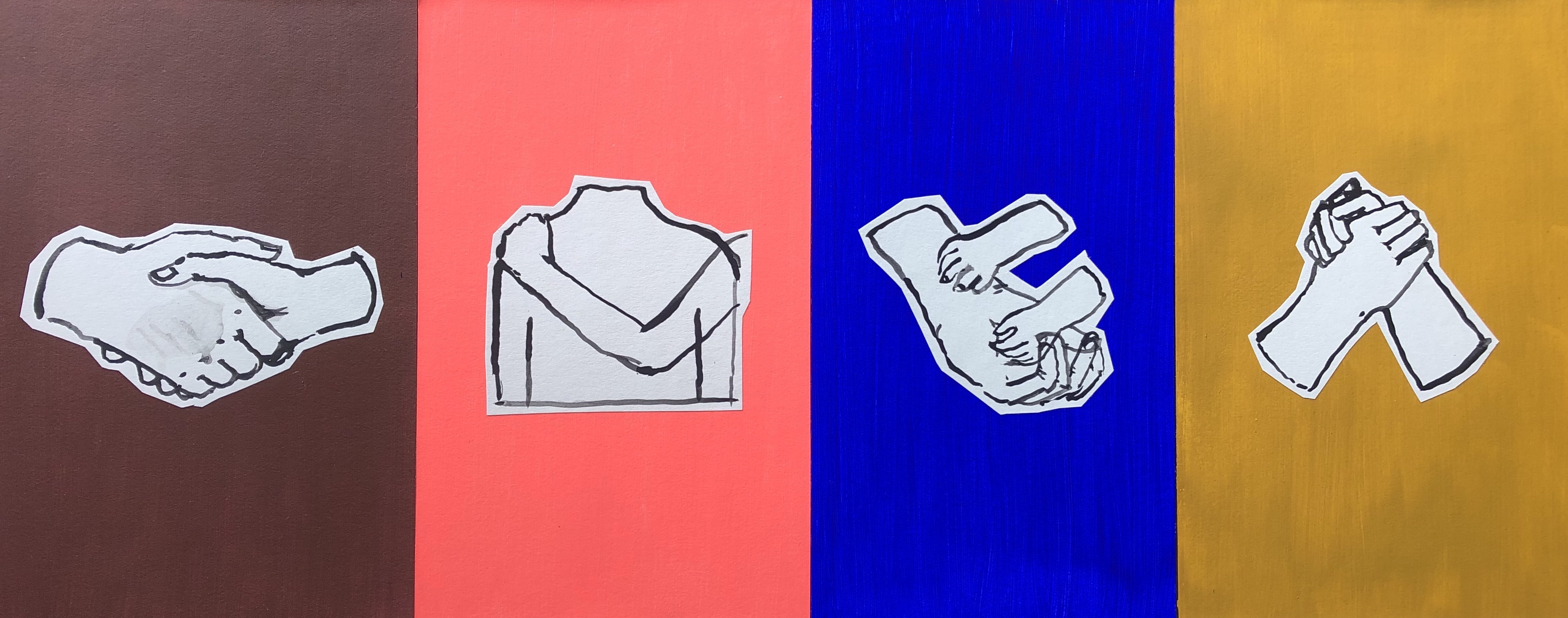Berlin Fallstudie
Urban Citizenship in Zeiten der Krise: Berlin
↓ Jump to Politikempfehlungen ↓
In dieser Fallstudie sind wir der Frage nachgegangen, wie Beratungs- und Nachbarschaftsorganisationen für Migrant*innen speziell in Berlin die Corona-Krise erlebt haben. Beratungs- und Nachbarschaftsorganisationen bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Stadtbewohner*innen und (lokalem) Staat. Ihre Arbeit und Vermittlung ist häufig nötig, damit Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte ihre Rechte geltend machen und soziale Teilhabe realisieren können. Mehr als ein Drittel aller Berliner*innen hat heute eine Migrationsgeschichte. Die Mitarbeitenden der Einrichtungen leisten (sprichwörtlich) Übersetzungsarbeit von komplexen bürokratischen Strukturen und Prozessen. Sie helfen bei der „Systemorientierung“, beim Schriftverkehr und bei der Beantragung von Aufenthaltstiteln, Zugang zu Wohnraum, Sprach- und Weiterbildungskursen sowie beim Zugang zur Gesundheitsversorgung. Ausgangspunkt unseres Projekts war die Vermutung, dass die Arbeit von Beratungsorganisationen für Migrant*innen durch Maßnahmen wie den Lockdown im Frühjahr 2020 erheblich erschwert wurde - mit weitreichenden Folgen für diejenigen, die auf Unterstützung angewiesen sind.
Forschung
Bei der Erhebung der empirischen Daten haben wir uns auf einen Berliner Bezirk mit einem hohen Anteil an Anwohner*innen mit Migrationsgeschichte und einer großen Dichte an Beratungsorganisationen konzentriert. Dort haben wir zunächst einen Survey durchgeführt und anschließend 15 vertiefende Interviews mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und Mitarbeiter*innen der Bezirks- und Senatsverwaltung geführt. Zeitlich haben wir uns an den ersten Lockdownphasen in 2020 und 2021 orientiert. Folgende Fragen leiteten die Forschung:
• Konnten die Organisationen ihre Arbeit unter Corona weiterführen?
• Was haben sie getan, um sich an die neue Situation anzupassen?
• Wie hat sich dadurch ihr Verhältnis zu und ihre Arbeit mit den Klient*innen verändert?
• Und wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit Ämtern, Behörden und städtischen Verwaltungen?
Ergebnisse
Folgt man der Forschungsliteratur über “städtische Resilienz”, so müsste man davon ausgehen, dass Berlin sich in dem hier untersuchten Bereich relativ gut an Krisensituationen anpassen kann. Über mehrere Jahrzehnte hinweg ist in der Stadt eine breite und institutionell abgesicherte integrationspolitische Infrastruktur gewachsen. Sie umfasst hoch professionelle Trägerorganisationen, kleine selbstorganisierte Vereine sowie soziale Unternehmen, die Beratungen und Ressourcen für Migrant*innen anbieten und oftmals öffentliche Mittel dafür erhalten. Darüber hinaus gibt es sowohl auf Senats- als auch auf Bezirksebene gut etablierte Schnittstellen zwischen den Verwaltungen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten wie z.B. Migrations- und Quartiersräte.
Obwohl diese Bedingungen in Krisenmomenten “Puffereffekte” entfalten und institutionelle Anpassungsprozesse erleichtern sollen, weisen die Ergebnisse unserer empirischen Studie in eine andere Richtung: Etablierte Abläufe innerhalb der Organisationen und Vereine, der Kontakt zu den Klient*innen und die Kommunikation mit Ämtern und Behörden kamen zeitweise fast völlig zum Erliegen. Zwar berichteten fast alle Organisationen, dass sie schlussendlich irgendwie weiterarbeiten konnten. Dies erfolgte aber mit teilweise erheblichen und auch länger andauernden Einschränkungen. Einige Programme, insbesondere solche, die von ehrenamtlichen Helfer*innen durchgeführt werden, wurden sogar ganz eingestellt. In den Organisationen selbst wechselten viele Mitarbeiter*innen ins Homeoffice, mussten die freien Sprechstunden einstellen und konnten nur noch telefonische und digitale Beratung anbieten. Selbstkritisch problematisierten Berater*innen, dass dies den Zugang für viele ihrer Klient*innen deutlich erschwerte. Es entstanden längere Wartezeiten für Beratungstermine. Dem stand eine wachsende Anzahl Klient*innen gegenüber. Viele Menschen verloren ihre Arbeit, bekamen Probleme mit ihren Aufenthaltstiteln und ihren Wohnungen oder verloren die Möglichkeit zu reisen. Manche Klient*innen brachen den Kontakt zu den Beratungsorganisation ab, andere nahmen ihn wohl gar nicht erst auf.
Ähnlich wie in der Fallstudie über Kopenhagen kam in Berlin besonders die zentrale Bedeutung der Ämter und Behörden für Migrant*innen zu tragen. Denn oftmals besteht die Arbeit der Beratungsorganisationen gerade darin, den Zugang zu den Verwaltungen zu erleichtern und bürokratische Verfahren zu begleiten. Vor diesem Hintergrund wurden die internen Umstellungen und Restriktionen in Ämtern und Behörden zu Beginn der Corona-Krise in den Interviews von den zivilgesellschaftlichen Akteuren als hochproblematisch beschrieben.
Vor allem im Vergleich zu unserer Tel Aviv Fallstudie hat es uns überrascht, wie wenig Raum es in Berlin für ad hoc Lösungen und institutionelle Innovationen gab. Stattdessen stellte die zeitweilige Schließung von Ämtern und Behörden und deren Wechsel von vor-Ort-Beratung zu telefonischen sowie Online-Angeboten für alle eine große Herausforderung dar. Diesen Wechsel konnten viele Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte nicht allein bewerkstelligen. Ihnen fehlten dafür häufig nicht nur die technische Voraussetzung (internetfähiges Gerät, W-Lan oder Datenvolumen), sondern auch die „soft skills“ (im Fachjargon „digital literacy“). In der Folge übernahmen oftmals Mitarbeitende der Beratungs- und Nachbarschaftsorganisationen die digitale Kommunikations- und Schnittstellenarbeit mit Behörden, richteten Email-Konten für Klient*innen ein oder bemühten sich über improvisierte Telefonschalten sprachlich zu vermitteln. Das jedoch führte in den Beratungsorganisationen zu einer erheblichen Steigerung des Arbeitsvolumens und der Arbeitsbelastung, was wiederum kaum kompensiert werden konnte. Auch viele Netzwerktreffen zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren konnten nicht in gleicher Form stattfinden. Das unterband den Austausch wichtiger Informationen und Ressourcen. Sie waren oftmals nur noch denjenigen zugänglich, die „gut vernetzt“ waren.
Auf unserer Website finden Sie zehn praktisch-politische Empfehlungen (siehe unten), die wir auf der Grundlage der Studie entwickelt haben, sowie eine Liste mit Internetlinks zum Weiterlesen. Bitte schauen Sie sich auch die Hinweise auf unsere Artikel und Vorträge auf der Hauptseite an. Und: Kennen Sie schon die anderen Forschungsprojekte, die am Lehrbereich Stadt- und Regionalsoziologie und am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung der HU Berlin angesiedelt sind?
Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Daniela Krüger und Henrik Lebuhn
Politikempfehlungen Berlin
- „Gut beraten: Bedingungen für Teilhabe an unterschiedlichen Beratungsformaten im Blick behalten“
Unter Corona stand der Ausbau digitaler Beratungsangebote im Mittelpunkt. Sie erlaubten es trotz Kontaktbeschränkungen Beratungen durchzuführen. Dieses Vorgehen hatte jedoch einen Nachteil: Nicht alle Menschen haben Zugang zu digitalen Endgeräten, W-Lan, oder besitzen die Fähigkeiten, digitale Angebote zu nutzen. Derlei Einschränkungen treten auch bei anderen Beratungsformaten auf. So setzen etwa face-to-face Angebote mit festem Termin eine gewisse Bewegungs- und Zeitautonomie voraus, was z.B. für alleinerziehende Mütter problematisch sein kann. Unter Corona ist hier ein allgemeines Problem besonders deutlich geworden: Beratungsformate müssen immer an unterschiedliche Kontexte und Zielgruppen angepasst werden. Dabei können unterschiedliche Formate zum Einsatz kommen, z.B. aufsuchende Beratung, offene Sprechstunde, digitale Angebote, etc. - „Gemeinsam regeln: Nicht-intendierte Folgen neuer Regeln und Abläufe abschätzen“
Krisen erfordern das Umstellen von Routinen. Organisationen wie Behörden sind neuen Bedingungen ausgesetzt, die das Anpassen von Regeln und Abläufen erfordern. Unter Corona betraf das z.B. das Abstandsgebot und die Schließung staatlicher Institutionen bzw. Umstellen auf telefonische und digitale Erreichbarkeit. Das Problem: Regeln haben häufig nicht-intendierte Folgen. Das kann dazu führen, dass Arbeitsprozesse von Beratungsorganisationen komplexer werden, was wiederum Menschen beim Zugang zu Ressourcen beschränkt oder sie ganz davon abschneidet. Die Anpassung von Regeln und Abläufen erfordert daher das sorgfältige Abschätzen nicht-intendierter Folgen. Dafür braucht es aufmerksame Schnittstellenarbeit und die Bereitschaft von Organisationen und Behörden, Regeln und Abläufe neu anzupassen. Wird ein solcher Prozess durch den Austausch zwischen Behörden und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen gemeinsam begleitet, werden die Folgen besser abschätzbar. - „Koordination in Krisenzeiten: Informationen weiterleiten und Handlungssicherheit herstellen“
Krisen erhöhen den Informationsbedarf für Beratungsorganisationen. Gerade in Krisenzeiten ist die Kenntnis aktueller rechtlicher Regelungen für die eigene Handlungssicherheit wichtig. Das Einholen von Informationen z.B. zu Gesetzesänderungen, der Umstellung von Verfahren, Zuständigkeiten und Öffnungszeiten ist für Organisationen aber mit einem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Zugleich kommt es zu einem Informationsungleichgewicht zwischen Organisationen, wenn nicht alle gleichermaßen mit Informationen und Handlungssicherheit ausgestattet werden. Gut sichtbare Ansprechpartner*innen in den Verwaltungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen können verfahrenstechnische Informationen in Krisenzeiten bündeln, an alle weiterleiten und damit einem Informationsungleichgewicht vorbeugen. - „Vernetzt euch: Vernetzung und Informationsaustausch unter Beratungsorganisationen stärken“
Beratungsorganisationen, die vor Corona bereits gut vernetzt waren, konnten in der Krise besser agieren. Netzwerke ermöglichen den Austausch von Informationen, Erfahrungen und Ressourcen. Netzwerke lassen sich jedoch im Moment der Krise nur schwer aufbauen. Sie müssen bereits vorher gefördert und dauerhaft gestärkt werden. Dies benötigt Kontinuität und kostet Zeit. Es braucht dauerhafte Netzwerkstrukturen wie Initiativforen und Runde Tische, die projektunabhängig bestehen. Zudem wird Netzwerkarbeit von Berater*innen oft zusätzlich, neben ihrer eigentlichen Arbeit geleistet. Gerade kleineren Organisationen fällt das schwer. Wird Netzwerkarbeit in die Förderung von Beratungsorganisationen eingepreist und unterstützt, investieren Förderinstitutionen in gegenseitigen Austausch und Hilfen – auch in Krisenzeiten. - „Autonomie wahren: Vorsicht bei Schnittstellen- und Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und Beratungsorganisationen“
Unter Corona verstärkten staatliche Behörden die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen. Sie wurden bspw. häufiger als direkte Ansprechpartner*innen in der Bearbeitung von Fällen kontaktiert (wenn die Vormundschaft geklärt war). Diese Entwicklung wurde von Beratungsorganisationen positiv eingeschätzt. Vorsicht ist jedoch geboten: Es ist zu klären, ob Beratungsorganisationen als Partner*innen auf Augenhöhe anerkannt oder Arbeitslasten umverteilt werden. Und: Je enger Beratungsorganisationen mit staatlichen Behörden in informellen und formalen Strukturen zusammenarbeiten, desto stärker ist davon evtl. auch ihre Autonomie berührt. Das Besondere von NGOs ist aber gerade ihre relative Unabhängigkeit. Wie kann diese gewahrt bleiben oder gar ausgebaut werden? Eine positive Annäherung zwischen Behörden und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen sollte durch sorgfältiges Abwägen begleitet werden: Welche Vorteile ergeben sich aus der Zusammenarbeit für die Beratungsorganisationen und Klient*innen, welche Nachteile ergeben sich z.B. mit Blick auf Vertrauensbeziehungen zu Klient*innen, Datenschutz und politische Unabhängigkeit. - „Übersehen: Die Care-Krise betrifft auch die Nachbarschaftsorganisation“
Corona führte zu einer Zuspitzung der Care-Krise. Beschäftigte in Krankenhäusern, medizinischen Praxen, Kitas und Schulen leisten viel und erhalten dafür wenig Anerkennung. Auch die Berater*innen migrantischer Organisationen stehen oftmals täglich im direkten Kontakt mit benachteiligten Menschen. Mit ihrer Arbeit erhöhen sie Teilhabechancen. Sie versorgen diejenigen, die systematisch übersehen und ausgeschlossen werden. Dies wird öffentlich wenig wahrgenommen. Die Arbeit und der Schutz von Berater*innen muss daher in Krisen- wie ‚Normalzeiten‘ mitgedacht werden. Das betrifft z.B. die Reduzierung von Arbeitsbelastung (siehe Pkt. 7), die materielle Honorierung und den Gesundheitsschutz (bspw. Impfpriorisierung, Schutzausstattung, etc.). - „Finanzierung sichern, Angebote ausbauen“
Besonders in Krisen entsteht eine Gemengelage von Problemen. Vorhandene Problemlagen spitzen sich zu. Zu ihnen gesellen sich neue. Während Corona erhöhte sich der Beratungsbedarf von Migrant*innen. Menschen verloren ihre Arbeit, ihren Aufenthaltsstatus, ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung, ihre Wohnung und die Möglichkeit zu reisen. Sie standen einer Beratungslandschaft gegenüber, die bereits vor Corona an ihre Kapazitätsgrenzen stieß. Obgleich Beratungsorganisationen dauerhaft gebraucht werden, ist ihre Finanzierung kurzzeitig und meist gebunden an Projektlaufzeiten. Eine solide Grundfinanzierung und mehr dauerhafte Angebote in unterschiedlichen Sprachen werden gebraucht, um die Arbeit von Beratungsorganisationen abzusichern und damit die soziale Teilhabe von Menschen in ‚Normalzeit‘ wie in Krisen zu stärken. - „Verfahren vereinfachen, Zugänge stärken: Corona als Window of Opportunity“
Während Corona wurden nicht nur neue Regeln geschaffen und Restriktionen eingeführt (siehe Pkt. 2), staatliche Behörden setzten auch Regeln aus, schufen und nutzen Handlungsspielräume. So wurden Fristen für die Abgabe von Dokumenten und Anträgen (bspw. im Jobcenter und im Landesamt für Einwanderung) ausgesetzt oder verlängert, Screening- und Abrechnungsverfahren vereinfacht (bspw. bei der Prüfung der Leistungsberechtigung oder der Abrechnung von Leistungen für nicht-krankenversicherte Menschen zwischen ärztlichen Praxen und KV). Dies stärkte den Zugang zu Ressourcen für viele Menschen. Was zu Krisenzeiten funktioniert, geht auch in ‚Normalzeiten.‘ Die Vereinfachung von Verfahren erleichtert die Arbeit von Beratungsorganisationen und Behörden. Es stellt einen Abbau von Zugangsschranken zu Ressourcen dar und hilft damit allen Beteiligten. - „Gesundheitsversorgung für alle: Versorgungssysteme öffnen“
Obwohl die Pandemie als ‚Gesundheitskrise‘ verhandelt wurde, blieb einigen Menschen weiterhin der Zugang zur medizinischen Regelversorgung verwehrt. Das verletzt das Recht von Menschen auf Gesundheit. Besonders widersprüchlich ist dabei: Menschen ohne Krankenversicherung oder mit anderen Zugangsbarrieren waren häufig stärker von Coronainfektionen und schweren Krankheitsverläufen betroffen. Statt Parallelsysteme und Notlösungen zu schaffen, gilt es, die Barrieren im Regelsystem abzubauen und die Versorgungssysteme zu öffnen. Das erhöht die Chancen von Menschen, ihre Gesundheit versorgt zu sehen und Krankheiten vorzubeugen. - „Gesundheit umfasst mehr: Gesundheit wird auch in Beratungsorganisationen gemacht“
Während der Pandemie wurde deutlich, dass nicht das Virus allein krank macht. Gesundheit und Krankheit werden durch Zugänge zu Wohnen, Arbeiten, Essen, Bildung, Gemeinschaft usw. beeinflusst. Beratungsorganisationen unterstützen daher die Gesundheit nicht nur, wenn sie medizinische Hilfe vermitteln. Auch wenn sie Menschen in anderen Bereichen helfen, stärken sie deren Gesundheit. Ein ganzheitlicher Beratungsansatz braucht dabei auch ein administratives Gegenüber. Nicht nur Beratungsorganisationen, sondern auch Behörden und Verwaltungen sollten die ressortübergreifende Kommunikation und einen integrierten Handlungsansatz stärken.
Weiterführende Links (in alphabetischer Reihenfolge):